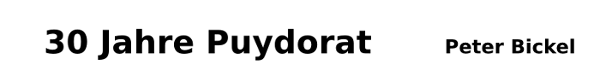
Unfertiges |
2015-11-08 Haus und HofPuydorat ist ein Weiler mit sieben Häusern, von denen einige ständig bewohnt, einige Résidences Secondaires sind. Die Häuser liegen weit auseinander auf der Höhe eines Hügelzugs, parallel zur Route Nationale 21 Paris - Agen. Unser Haus liegt am südlichen Rand der Häusergruppe und blickt in ein kleines Tal und an den gegenüberliegenden Wald. Wir haben uns angewöhnt, unser eigenes Haus einfach Puydorat zu nennen, und ich werde das hier auch so halten. Wohnhaus ...Puydorat ist ein Doppelhaus, es wurde bis nach dem zweiten Krieg von zwei Familien bewohnt und bewirtschaftet und hat darum auch zwei Scheunen und Ställe. Quer durch den Hof ging eine Mauer zum Brunnen, den sie gemeinsam benützten. Das Wohnhaus ist zweistöckig, was man in der Gegend eher selten sieht. Sonst fällt es im Weiler aber nicht aus dem Rahmen, den hellen, gelben Kalkstein und die steilen Dächer haben alle gemeinsam. Dadurch wirkt die Häusergruppe geschlossen, obwohl jedes Haus seinen ganz eigenen Charakter hat. Als wir dem Haus 1985 zum ersten Mal begegneten, trug es einen grauen Verputz. An den Ecken waren verschränkte Steine aufgemalt, die Pierres d'Angle, auch die Fenstereinfassungen trugen aufgemalte Umrandungen. Wir vermuten, dass diese Dekoration im Zug der Renovierungen in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts entstand. Damals wurden auch die grossen Fenster in die Südfassade gebrochen und die Zisterne gebaut. Es war in ganz Europa eine Weile lang Mode, Bauernhäuser durch Verputzen in vornehme Stadthäuser zu verwandeln: Mauern aus Feldsteinen und Riegelwerk verschwanden unter einer glatten Maquillage. Es war üblich den Verputz dunkelgrau zu streichen, Schmutz und Verwitterung taten ein übriges und bald wirkten die Häuser düster und abweisend. Viele der sich heute in hellem Kalkstein zeigenden Dordogne-Häuser wurden auf diese Weise modernisiert und verdüstert und einige Generationen später wieder zurückrenoviert. Bereits unsere Vorbesitzer begannen damit, den Putz zu entfernen - uns blieb nur ein kleiner Rest dieser Arbeit. Alle Gebäude im Weiler haben sowohl steile keltische Dächer als auch flache römische. Wenn Sie Richtung Osten ins Périgord noir fahren, verschwinden die römischen Dächer. Und wenn Sie sich südlich von Bergerac umsehen, finden Sie fast ausschliessich römische. Wir sind in einer Mischzone, wo die beiden Dachformen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wenn Sie Gelegenheit erhalten, Scheunen und Schuppen von innen zu sehen, sollten Sie die Formen der Dachstühle beachten: Sie sind von ganz verschiedener Konstruktion. Das römische Dach tragen mehrere Balken, die parallel zum First auf die Mauern gelegt sind, das keltische Dach hat eine aufwenige Zimmermannskonstruktion. Das keltische Dach hat eine Dachneigung von rund 60 Grad und ist mit flachen Ziegeln - den Tuiles Plâtes - gedeckt. Sie gleichen den Biberschwanz-Ziegeln des Nordens, sind aber am unteren Rand gerade abgeschnitten. Ich nehme an, dass diese Dächer früher mit Stroh gedeckt waren, habe aber bisher keine Beweise für meinen Verdacht gefunden. Die Dachneigung des römischen Dachs liegt um 18 Grad, die ursprüngliche Deckung bestand aus Hohlziegeln, wie sie die Römer mitbrachten. Diese Deckung wird auch etwa als Mönch und Nonne bezeichnet, weil jeweils eine Ziegelreihe schalenförmig und die nächste haubenförmig verlegt wird. Wir haben diese Dächer mit modernen Doppelfalz-Ziegeln neu gedeckt, die optisch den Eindruck der Originaldeckung vermitteln. In Puydorat liegt der Fels unmittelbar unter der Erdoberfläche, an einigen Stellen wird er auch sichtbar. Alle Häuser stehen unmittelbar auf diesem Kalkfelsen und sind damit wohl für die Ewigkeit gebaut. Das aufsteigende Mauerwerk ist als Trockenmauer aus Feldsteinen geschichtet, die Hohlräume sind mit Lehm gefüllt, die Fugen zwischen den Steinen wurden innen und aussen mit einem Luftkalk-Mörtel verfugt. Die Mauern sind im Erdgeschoss 70 bis 80 Zentimeter, im Obergeschoss 40 bis 60 Zentimeter dick. Die Feldsteine für das Mauerwerk stammen aus den umliegenden Äckern, die Pierres d'Angle in den Hausecken aus örtlichen Steinbrüchen, alles Material musste mit Ochsenkarren zum Bauplatz gebracht werden. Die Zwischenböden und die Dachstühle sind aus dauerhafter Eiche. Wenn Sie die riesigen Balken genauer ansehen, bemerken Sie sofort, dass sie von einem früheren Bauwerk stammen: Sie sind voller Ausschnitte und Zapfenlöcher, stammen also offensichtlich vom Abbruch. Man weiss, dass die Bauern nach der Revolution die Behausungen der verhassten Herren als Steinbrüche benutzten, sich eben holten, was sie brauchten. Da grosse Eichenbalken kaum länger sieben Meter sind, ist die Raumtiefe auf etwa sechs Meter begrenzt, die Raumhöhe schwankt bei uns bei etwa drei Metern. Das ergibt Räume von 30 oder mehr Quadratmetern, was offenbar früher durchaus normal war. Drei solcher Räume reichten für eine sechs- bis achtköpfige Sippe durchaus: Einer diente als Wohnküche, die übrigen als Schlafräume. Ursprünglich waren alle Räume durch offene Kamine beheizbar, in der Küche diente der Kamin auch als Kochenstelle. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass die ältesten Teile unseres Hauses bereits im 18. Jahrhundert bestanden und nur einstöckig waren. Später wurden, wenn mehr Platz gebraucht wurde, Räume hinzugefügt. Auch die Etage kam erst später hinzu, sie war bis zum grossen Umbau in den fünfzier Jahren über eine steinerne Aussentreppe erreichbar. Der jüngste Teil ist zweifellos der Nordwest-Flügel, wo Gast- und Kinderzimmer des Gîte liegen; dort sind die Mauern nur 40 Zentimeter dick. Halten Sie sich immer vor Augen, dass die Häuser auf dem Land von den Bauern selber gebaut wurden. Die Nachbarn waren verpflichtet, einander dabei zu helfen, so wie man viele schwere oder aufwendige Arbeiten gemeinsam ausführte. Im Gegensatz zu heute fiel ausser Speis und Trank für die Helfer kein Arbeitslohn an. Schwer beschaffbar und darum teuer waren die Materialien: Steine, Holz, Kalk und Beschläge, insbesondere wenn Sie von weit her geholt werden mussten. ... und DépendencesZu einem Bauernhaus gehören natürlich Scheunen, Ställe und Schutzbauten für Maschinen und Fuhrhabe, Dépendences eben. In Unserem Fall waren es gleich zwei Scheunen mit Ställen, denn jede der beiden Familien bewirtschaftete den Boden in eigener Veranwortung. In jedem der Ställe waren Anbindeplätze für acht bis zehn Stück Grossvieh, Kühe und Ochsen, die man als Zugtiere brauchte. Über den Ställen war Platz für das Futter, im Stall Ost lag sogar noch ein beachtlicher Vorrat an halb verrottetem Heu. Separate Ställe für das Hausschwein samt Futterküche, die Hühner und die Enten waren auch da, allerdings in desolatem Zustand. Die Bauten stammten natürlich aus einer Zeit, da man alles von Hand machte. Und es brauchte seine Zeit und einige Irrtümer, bis wir lernten, unser Heu mit Hilfe von Maschinen einzubringen. Raum zum Versorgen unserer Geräte und Maschinen fehlte am Anfang, Traktor und Maschinen standen im Freien und rosteten vor sich hin. Bei den Bauern in der Umgebung standen riesige Remisen aus Metall, aber so etwas konnten und wollten wir uns nicht leisten. Es musste auch anders gehen, eben so, wie meine Nachbarn im Zollikerberg um 1950 bauerten, mit einfachsten Hilfsmitteln und viel Handarbeit. Von diesen Erinnerungen habe ich oft profitiert, sie gaben viele Anregungen. Feld ...Die Landschaft nördlich der Dordogne ist waldreich und kupiert, die Felder sind klein und in den Wald hineingeschnitten und nur mühsam zu bebauen - hier ist keine industrielle Landwirtschaft wie etwa im Pariser Becken möglich. Wer als Bauer in der globalen Produktion überleben will, muss Nischenprodukte finden oder Intensivkulturen anlegen: Erdbeeren, Spargeln, Gemüse. Dazu fehlten uns am Anfang aber nicht nur die Mittel, sondern auch die Ausbildung und Erfahrung: Bei unserem Nachbarn Joël sahen wir, wieviel es braucht, marktgerecht zu produzieren - nein, dem waren wir nicht gewachsen. So blieben unsere fünf Hektaren Wiesland eben Weide- und Heuland, das unsere Schafherde ernährte und uns indirekt mit Fleisch versorgte. Rund um das Haus und in den sanft abfallenden Pentes ist der Kalkfelsen allgegenwärtig, wir sind im Wahrsten Sinne des Worts steinreich! Mehr als 20 bis 30 Zentimeter Humus liegen nicht über dem Fels, an vielen Stellen kommt er an die Oberfläche und stört beim Mähen. Diese Flächen sind von wenig wertvollen Gräsern besetzt, denn sie trockenen in heissen Sommern vollständig ab und werden braun. Sie eignen sich im Frühling und Herbst für eine kurze Weide, aber kaum zum Anbau von Korn oder Kartoffeln. Landwirtschaftlich ertragreich nutzbar ist nur der Talgrund, wo wir über all die Jahre unser Heu gemacht haben, und eine Art Senke im felsigen Untergrund östlich des Hauses, die zur Nutzung als Potager geeignet war. Also eine eher karge Landschaft, die zur Ernährung einer Bauernfamilie wohl schon in früherer Zeit nur knapp ausreichte. Allerdings war der Hof zur Zeit der Martys wohl deutlich grösser. ... und WaldWenn sie vom Haus südwärts an den gegenüberliegenden Wald blicken, sehen Sie Laubwald, bestanden mit Kastanien, Eichen und weiterem Laubholz und einigen Kiefern, das sind unsere anderen fünf Hektaren. Dieser Hang sah nicht immer so aus: Bis in die 1960er Jahre war hier eine Châtaigneraie, ein Kastanienhain, bestehend aus in grossem Abstand gepflanzten riesigen Bäumen. Es waren veredelte Kastanien, nach den Überresten zu schliessen wohl hundert und mehr Jahre alt. Im Sommer wurde das Vieh zum Weiden hineingebracht, es hielt den Boden sauber. Im Herbst wurden die Kastanien zusammengelesen, getrocknet und zu Mehl verarbeitet. Wie in Italien, Spanien und der Südschweiz war die Kastanie ein wichtiges Nahrungmittel, die Kartoffel der Armen wurde sie auch genannt. Ausser den gut bekannten über dem Feuer gerösteten Kastanien - heissi Maroni - wurde vor allem Kastanienbrot gegessen. Ein schwerer Sturm in den sechziger Jahren vernichtete die Pracht, die alten Bäume wurden zum Teil entwurzelt, zum Teil die Kronen an der Veredlungsstelle abgebrochen. Sicher war der Hain schon damals überaltert, die Bäume nicht mehr sehr widerstandsfähig und schon lange nicht mehr bewirtschaftet. Einige Stämme stehen allerdings noch heute da und dort aufrecht, auch einige vom Sturm verschonte Exemplare kann man finden. Kastanien- aber auch Eichen- und Hagebuchensämlinge übernahmen den Platz und bildeten bald einen lichten, halbhohen Wald, der nach 15 bis 20 Jahren auf Stock geschnitten wurde. Die Kastanie erträgt das ohne weiteres, sie schlägt wieder aus und liefert so in regelmässigem Abstand Brennholz, bildet aber keine grossen Bäume. Der regelmässige Schnitt gab der Nutzung den Namen: le Tailli. Auch wir haben den Wald so genutzt, uns Jahr für Jahr unsere zwanzig Ster Brennholz geholt und damit von Oktober bis April das Haus warm gehalten. Heizen mit Holz ist zwar arbeitsaufwendig aber billig, wenn man wie wir eigenen Wald hat. Kastanien geben ein vorzügliches Brennholz und mit Holz zu heizen ist sehr ökologisch. Von der früheren châtaigneraie wurde uns schon bald nach unserer Ankunft erzählt und wir spielten einige Zeit mit dem Gedanken, sie wieder erstehen zu lassen. Wir besuchten Demonstrationen der Versuchsstation in Maison Janette an der RN21, bestellten einen Berater vom Chambre d'Agriculture und fuhren auch zu Bauern, die Kastanienpflanzungen pflegten. Es war ganz und gar nicht ermutigend! Überall wurde über die drohende Vernichtung der Kastanienbäume gesprochen, von der Hilflosigkeit den Krankheiten gegenüber und es wurde uns klar, dass unser Vorhaben ein grosses Risiko war und wir es besser beerdigen sollten. Es war eine kluge Entscheidung! Heute ist unser Wald im Umbruch: die Kastanie ist am Sterben, überall stehen laublose, tote Stockausschläge. Ein Pilz und ein Virus lassen die Stöcke absterben, Hilfe ist nicht in Sicht. Unserer Holznutzung kommt das aber durchaus entgegen, seit etwa zehn Jahren schneiden wir unser Brennholz im Sommer - es steht ja bereits getrocknet auf den toten Strünken... Und wo Licht und Luft auf den Boden kommt, entsteht ein Teppich von Sämlingen: Eichen, Hagebuchen, Kirschen, Linden, Eschen. Der Wald stirbt also nicht, er wandelt sich und in zwanzig, dreissig Jahren wird die Kastanie wohl verschwunden sein. |